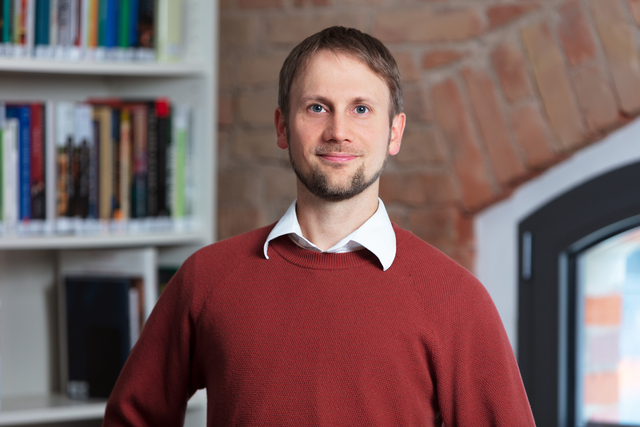Kommissionen sollen unsere Demokratie unterstützen. Dafür müssten sie aber Lernprozesse ermöglichen.
Die „Kohlekommission“ überraschte Ende Januar mit einem beeindruckenden Konsens. Sie hat die Klimaschutzziele mit wirtschaftlichen und sozialen Perspektiven für die Kohleregionen unter einen Hut gebracht. Mit ihren Empfehlungen setzt sie die bislang handlungsscheue Politik beim überfälligen Kohleausstieg unter Zugzwang. Schließlich verschaffte die prominente Kommission diesem Thema nicht nur mediale Aufmerksamkeit, sondern genießt gewisse Legitimität und Autorität in der Öffentlichkeit.
In ungebrochenem Eifer richtet die Beratungsrepublik Deutschland solche Expertenkommissionen zu komplexen Politikproblemen ein. Nicht weniger als 21 verschiedene erwähnten Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag, aktuell ist etwa von entsprechenden Gremien zur Digitalisierung im Alltag, zur Wärmewende in Gebäuden oder zur Mobilität der Zukunft die Rede. Verschiedene Verbände sowie wissenschaftliche Expertise sind darin vertreten. Sie sollen möglichst konsensual Empfehlungen für die Regierung erarbeiten.
Tatsächlich verstand es die Bundesrepublik dank solcher Kommissionen oft, in großen politischen Fragen einen gesellschaftlichen Konsens herzustellen. Zumindest unter den wichtigsten Verbänden etwa der Wirtschaft, Industrie, Gewerkschaften oder Kommunen. Ob uns derzeit die USA oder Großbritannien heimlich um diese korporatistische Tradition beneiden?
Sie sollten zumindest vorsichtig sein. Am Ende war die Kohlekommission vornehmlich geprägt von internem Gerangel um Kompromisse über hochumstrittene Zeitpläne und Milliardensummen. Dadurch ist der gerühmte Kohlekompromiss womöglich überteuert erkauft, unter anderem zu Lasten der Steuerzahlenden. Die kritischen Wortmeldungen aus verschiedenen Parteien lassen erahnen, wie flüchtig ein solch hart erarbeiteter Kompromiss sein kann, wenn er hernach keinen Abnehmer findet. Wie gut dienen derart strukturierte Kommissionen der Gesellschaft also wirklich?
Transparente Handlungsmöglichkeiten statt Korporatismus
Mit einem anderen Mandat – dem Ausleuchten von Politikalternativen – hätte die Kohlekommission unsere parlamentarische Demokratie besser unterstützen können. Sie hätte in einem transparenten, gemeinschaftlichen Verfahren systematisch die möglichen Auswirkungen verschiedener politischer Handlungsalternativen untersuchen sollen im Lichte unterschiedlichster Wertvorstellungen. Am Ende würde die Kommission der Öffentlichkeit demnach nicht eine bestimmte, hinter verschlossenen Türen ausgehandelte Politikempfehlung präsentieren.
Sie würde vielmehr über Vor- und Nachteile von Politikalternativen informieren und damit einen Lernprozess ermöglichen. So hätte die Kohlekommission die empfohlenen Entschädigungszahlungen an Kraftwerksbetreiber mit anderen Ansätzen, etwa der effektiven CO2-Bepreisung, vergleichen sollen, um die langfristigen Folgen für Klimaschutz und Staatshaushalt jeweils deutlicher werden zu lassen.
Zukünftige Kommissionen müssen zu einem solchen Zweck noch diverser aufgestellt sein, was relevante gesellschaftliche Perspektiven angeht. Das sollte die Oppositionsparteien miteinschließen, welche in der Kohlekommission nicht vertreten waren. Zudem muss der oft fragmentierte wissenschaftliche Kenntnisstand zu alternativen zukünftigen Politikpfaden und deren Implikationen hierfür umfassender einbezogen werden als etwa in der Kohlekommission – mit expliziten Hintergrundannahmen, Vergleichbarkeit und einem breiten Spektrum an Bewertungskriterien.
Ein solches Verfahren bewirkt zunächst, dass sich die Kommissionsmitglieder ihrer eigenen Überzeugung noch klarer werden. Sie sind nämlich gezwungen, ihre jeweilige Sicht konsistent und begründet in konkrete Politikpfade sowie mögliche Konsequenzen zu übersetzen – im ständigen Vergleich mit anderen Handlungsalternativen. Das könnte nebenbei Lobby-geprägte Gutachten und populistische Parolen gleich welcher politischen Couleur in der öffentlichen Debatte entlarven helfen.
Im Idealfall hilft dieses Verfahren dann diejenigen Politikoptionen zu identifizieren, die tatsächlich am ehesten den diversen gesellschaftlichen Zielen und Werten gerecht werden könnten und dabei Zielkonflikte minimieren. Es kann auch dazu führen, dass die verschiedenen Standpunkte wechselseitig besser verstanden und dadurch eventuell mehr wertgeschätzt werden. Das macht spätere politische Kompromisse einfacher und tragfähiger.
Manchem mag in diesen Zeiten eine solche Offenheit gegenüber Handlungsalternativen zu mutig erscheinen aus Furcht, zweifelhafte Politikoptionen damit gesellschaftlich salonfähig zu machen. In einer Demokratie müsste man dann aber mindestens für volle Transparenz der Wertannahmen sorgen, die den intern vorsortierten Politikoptionen zugrunde liegen. Zudem muss man sich die Frage gefallen lassen, ob eine solche Vorauswahl das zunehmende gesellschaftliche Misstrauen in als elitär wahrgenommene Politikprozesse nicht noch weiter schürt – woran auch die Milliardenbeträge für strukturschwache Regionen nichts ändern werden.
Zukünftige Kommissionen sollten also keine politischen Entscheidungen vorwegnehmen, sondern die demokratisch gewählten Regierungen und Parlamenten über Handlungsalternativen informieren und ihnen auf dieser Basis das Aushandeln demokratischer Kompromisse verantwortlich überlassen. Schließlich gründen solche Entscheidungen trotz aller technischen und wissenschaftlichen Aspekte wesentlich auf ethischen Urteilen und Risikobewertungen.
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir nicht Expertenkommissionen mit der Entscheidung für oder gegen bestimmte Politikpfade beauftragen sollten: Der realweltliche Erfolg von Politikempfehlungen wie diejenigen der Kohlekommission hängt stark von entschlossenem und gezieltem politischen Handeln in den kommenden Jahren ab. Die Verantwortung sowohl für die Richtungsentscheidung als auch die Umsetzung sollte folglich primär bei der Regierung liegen. Man könnte die Entscheidungen von Regierungen anhand der transparenteren Politikalternativen hernach außerdem viel handfester evaluieren.
Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen
Der vorgeschlagene Ansatz verhindert aber nicht nur eine taktische Auslagerung von demokratischer Regierungsverantwortung auf Kommissionen. Er verhilft demokratisch gewählten Regierungen in Zeiten von mächtigen globalisierten Unternehmen sowie Politikverdrossenheit umgekehrt zu expliziterem Handlungsspielraum und womöglich wieder Vertrauen seitens der Bevölkerung.
Das alte korporatistische Konsensmodell für die Kommissionen ist in Zeiten hochkomplexer Politikprobleme und aufstrebendem Populismus jedenfalls an seine Grenzen gekommen. Im Vergleich zu den Milliardenausgaben der Regierung für Beratungsfirmen oder den indirekten Kosten schlechter Politikentscheidungen erscheint der hohe zeitliche und finanzielle Aufwand für das partizipative und transparente Erhellen alternativer Pfade gerechtfertigt. Dieser neue Ansatz für zukünftige Kommissionen wäre ganz im Sinne einer deliberativen Demokratie – als Weiterentwicklung unserer repräsentativen, korporatistischen Demokratie und als Alternative zum Schweizer Modell einer direkten Demokratie. Deliberative Demokratie betont stattdessen Lernprozesse und konstruktive Politikdebatten, die nicht bloß von Kompromissen verschiedener, unterschiedlich potent organisierter Eigeninteressen geprägt sind, sondern zuallererst von der Frage, was gut für uns als Gemeinschaft ist.
Zuerst erschienen in Tagesspiegel Background Energie & Klima